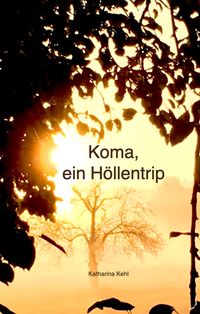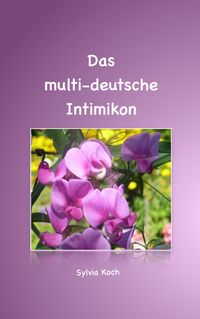Es ist Ostern
Wir feiern das Hochfest der christlichen Kirche, ihr Fest aller Feste.
Es ist weniger gefühlsbetont und idyllisch als die Weihnacht. Denn das Osterthema handelt von Tod und Auferstehung. Es ist tragisch in sich und deshalb nicht so leicht zu vermitteln wie das familiäre Christfest.
Jedoch:
Nur mit Ostern bekommt die Jesusgeschichte einen Sinn.
Es geht um den Sieg des Lebens über den Tod, die Verwandlung von Leid in Glück.
Die etymologische Herkunft des Wortes Ostern ist umstritten. Die vielzitierte Frühlingsgöttin Ostera lässt sich nicht nachweisen. Sie wurde möglicherweise erst im Nachhinein herangezogen, um einen Ursprung zu (er)finden. Was hingegen anzunehmen ist: Sprachgeschichtlich stammt Ostern von der griechischen Morgenröte Eos ab, welche altgermanisch austrô erscheint. Das klingt durchaus plausibel, wird doch in der Osternacht gebetet bis zum Morgenrot. Auch die Nähe zum slawischen utro, dem Morgen, sowie zur Himmelsrichtung Osten, wo bekanntlich die Sonne aufgeht, unterstützt diese These. Hierin ist sich die indoeuropäische Sprachenfamilie erfreulich einig.
Die Osterfastenzeit dauert sechs Wochen, wobei jeder Woche eine besondere Bedeutung zukommt. Die ersten fünf Sonntage sind benannt nach den Anfangsworten des Stufengebets, des Eröffnungsverses der Messe.
- Invocavit/Invocabit – lat.: Er hat (mich) angerufen. Funken-, Scheibensonntag; Trommelfest in der Schweiz
- Reminiscere – lat.: Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit.
- Oculi – lat.: Meine Augen sind immer auf den Herrn gerichtet. Fastenmarktsonntag
- Laetare – lat.: Freuet Euch mit Jerusalem. Mittefasten, Rosen-, Liebstattsonntag. Nachdem der erste Teil der Fastenzeit der Besinnung und Trauer galt, kann der Gläubige nun froh dem Palmsonntag entgegensehen.
- Judica – lat.: Gott, schaffe mir Recht. Erbsen-, Erster Passionssonntag; Verhüllung des Chorraumes mit Hungertüchern
- Palmarum – Palmsonntag; Weihe der Palmzweige. Dieser Tag erinnert an den Einzug Jesu in Jerusalem, seinen Opfertod am Kreuz und die Erlösung. Palmblätter gelten deshalb als Siegeszeichen. Es finden Prozessionen statt. In unseren geografischen Breiten allerdings werden die Palmwedel durch Buchsbaum- und Weidenkätzchenzweige ersetzt, die mit Immergrün und Stechpalmenzweigen gebunden und mit roten Bändern und Schleifen verziert werden.
Im Mittelalter führte eine Eselin die Palmsonntags-Prozession an. Auf ihr ritt ein als Christus gekleideter Geistlicher. Da Eseltieren jedoch jegliches Verständnis für religiöse Rituale abgeht, sie hingegen eine obligate, wenngleich kluge Sturheit besitzen, wurden sie alsbald durch ein fahrbares, hölzernes Gestell esels-ähnlicher Gestalt ersetzt. Warum dabei auch der Christusreiter einem unbelebten Gebilde weichen musste, ist nicht belegt. Ob nun aus Allotria oder eigenwilliger Frömmigkeit heraus: Die nunmehr starre statt sture Eselin wurde in der Folgezeit mit mehr oder minder üppigem Blumenschmuck und Eierdekoration, auch mit Würsten und Backwerk geschmückt. Teils kam bedauerlicherweise auch die Christusfigur mit unbotmäßigem Beiwerk daher. Da das Ergebnis dieser Mühen zu häufig nicht mehr mit "künstlerischer Freiheit" entschuldigt werden konnte, sondern das kuriose Ganze zu Unfug und Schelmenstreich ausartete, wurde die Lastenträgerin nun völlig von der Prozession ausgeschlossen. In nur wenigen Pfarreien blieb ein hölzernes Grautier erhalten, das sein Dasein im Verborgenen fristet.
Doch auch familiär ist uns ein Palmesel vertraut: Denn so wird gerne das Familienmitglied benamst, das am Ostersonntag morgens als letztes aus dem Bett findet.
Mehr zu den Osterbräuchen
Ostern kulinarisch
Der Palmsonntag vor Ostern eröffnet die Kar-, die stille Trauerwoche. Die Wortsilbe kar basiert sprachlich auf dem althochdeutschen chara = Sorge, Trauer, Leid, Klage. Von daher ist uns Karges als Kümmerliches bekannt.
Die Karwoche
- Blauer Montag – Blau, die abgeschwächte Trauerfarbe, ist die in der Fastenzeit gebräuchliche Kirchenfarbe. Es werden Ornate in dieser Farbe getragen.
- Gelber / Blauer / Schiefer Dienstag – Auch Eierdienstag genannt, denn heute dürfen Eierspeisen gegessen werden.
- Weißer / Guter / Krummer / Schiefer Mittwoch, Platzmittwoch – Der Tag von Judas' Verrat gilt als Unglückstag. Obendrein ist die Wochenmitte, die Wotans Namen führt, heidnisch vorbelastet.
- Grüner / Weißer / Hoher Donnerstag, Antlasstag – Die ersten frischen Kräuter und Gemüse sind verfügbar und werden an diesem Tag zubereitet. Das Wort grün(en) verweist in diesem Zusammenhang auf grienen = greinen, weinen, trauern. Zeremoniell bedeutsam: In Anlehnung an die während des letzten Abendmahls von Jesus durchgeführte Fußwaschung bespritzen manche Pfarrer die Füße ihrer ältesten Gemeindemitglieder. Der Ritus allegorisiert Demut und Nächstenliebe.
- Stiller / Hoher / Weiß- / Karfreitag – Der Tag der Kreuzigung Christi ist tieftrauriger Höhepunkt der Karwoche. Christen üben strenges Fasten an diesem Tag der Buße.
- Kar- / Judas- / Färbersamstag, Großer Sonnabend – Tag der Grabesruhe. Die Trauer löst sich. Es ist Zeit, die Ostereier zu bemalen. Mit Anbruch der Dunkelheit beginnt die Osternacht. Der Karsamstag fällt wortwörtlich in die Karwoche, während der Ostersamstag am Ende der folgenden Woche liegt. Umgangssprachlich geht es mit diesen beiden Tagen allerdings munter durcheinander.
- Ostersonntag – Wir gedenken der Auferstehung; sie ist Christi Sieg über den Tod. Die Osterkerze wird geweiht. In Vorzeiten begann das neue Kirchenjahr, weshalb erst jetzt die neue Jahreszahl auf die Kerze geschrieben wird.
Am Ostermontag beginnt die freudige Osterzeit, die sich fünfzig Tage lang bis Pfingsten erstrecken wird.